Burnout-Prävention aus theoretischer Sicht – Modelle, Faktoren, Risiken
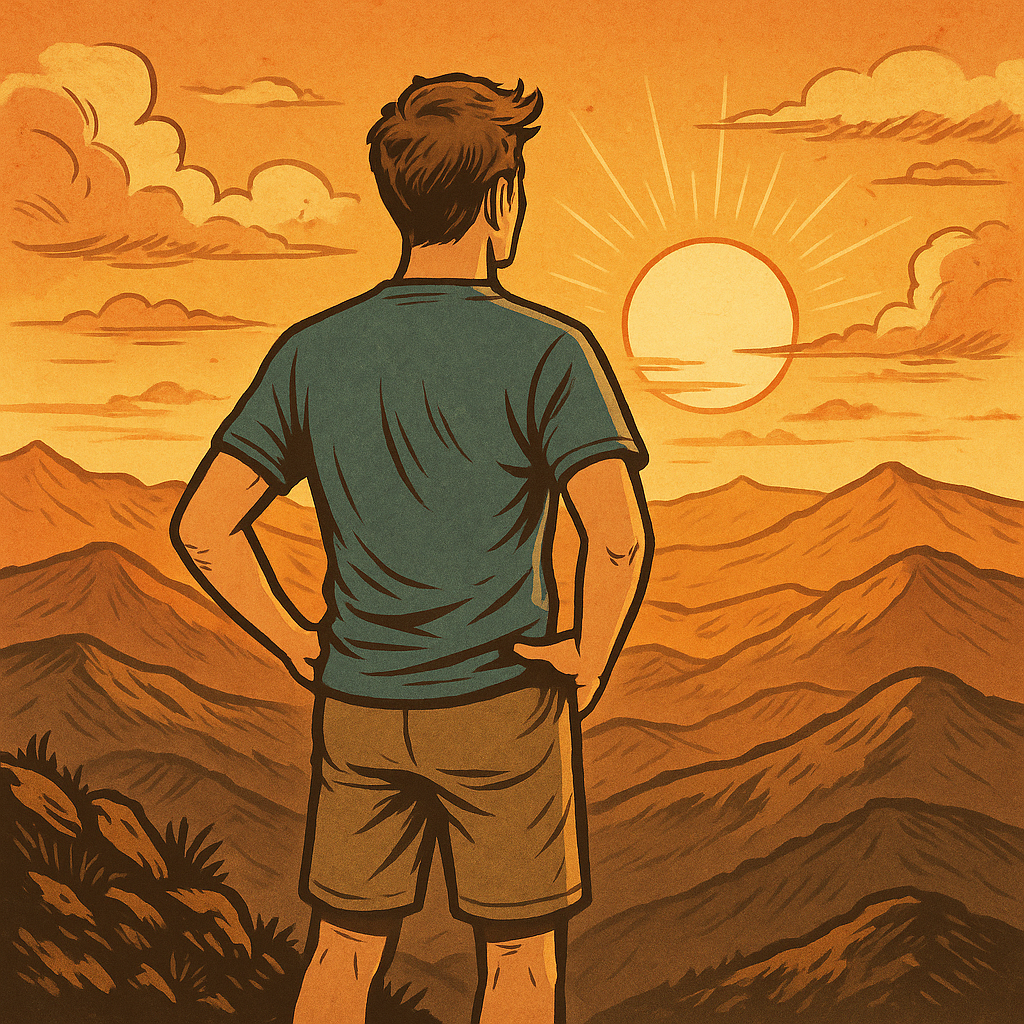
Burnout-Prävention ist mehr als ein Wellness-Wochenende oder das berühmte „bisschen mehr Selbstfürsorge“. Wer Burnout wirklich verstehen will, braucht ein klares Bild davon, wie Prävention auf theoretischer Ebene funktioniert – und welche Faktoren in Forschung und Psychologie als besonders schützend oder riskant gelten.
In diesem Artikel schauen wir uns die wichtigsten Modelle, Schutzfaktoren und Risikoansätze an, die in der Burnout-Prävention eine zentrale Rolle spielen.
Was meint „Prävention“ eigentlich?
In der Gesundheitspsychologie wird Prävention in drei Stufen unterteilt:
Primärprävention – Verhinderung des Auftretens (z. B. Stresskompetenz stärken)
Sekundärprävention – Früherkennung & Intervention (z. B. bei ersten Symptomen)
Tertiärprävention – Rückfallvermeidung nach Erkrankung
In der Theorie geht es bei Burnout-Prävention vor allem um die ersten beiden Ebenen – also darum, Frühwarnzeichen zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation zu verringern.
Modell 1: Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
Eines der wichtigsten theoretischen Modelle zur Burnout-Prävention stammt von Richard Lazarus:
Kernidee:
Stress entsteht nicht durch äußere Reize allein – sondern durch die individuelle Bewertung der Situation.
Ablauf:
Primäre Bewertung – Ist das ein Risiko für mich?
Sekundäre Bewertung – Habe ich genügend Ressourcen, um damit umzugehen?
Bewältigung (Coping) – Wie reagiere ich?
Relevanz für Burnout:
Menschen mit hohem innerem Druck, geringem Selbstvertrauen oder fehlender sozialer Unterstützung bewerten Belastungen häufiger als bedrohlich – und erleben dadurch eher chronischen Stress.
Modell 2: Salutogenese nach Aaron Antonovsky
Während die klassische Medizin fragt: „Was macht krank?“, fragt die Salutogenese:
👉 „Was hält gesund?“
Zentrale Idee:
Gesundheit ist ein dynamisches Kontinuum – beeinflusst durch das sogenannte Kohärenzgefühl („Sense of Coherence“, SOC).
Bestandteile des Kohärenzgefühls:
Verstehbarkeit: Ich kann einordnen, was passiert.
Handhabbarkeit: Ich habe Ressourcen, um damit umzugehen.
Sinnhaftigkeit: Es lohnt sich, mich einzusetzen.
Relevanz für Burnout:
Ein starkes Kohärenzgefühl schützt davor, in Überforderung zu geraten. Es fördert Resilienz – also psychische Widerstandskraft.
Risikofaktoren aus psychologischer Sicht
Bestimmte Merkmale und Bedingungen erhöhen laut Forschung das Risiko für Burnout:
| Kategorie | Beispielhafte Risikofaktoren |
|---|---|
| Individuell | Perfektionismus, hoher Leistungsanspruch, geringe Abgrenzungsfähigkeit |
| Sozial | Fehlende Unterstützung, Konflikte im Team, mangelnde Anerkennung |
| Organisatorisch | Unklare Rollen, überhöhte Arbeitslast, Zeitdruck, Kontrollverlust |
| Gesellschaftlich | Dauererreichbarkeit, ständiger Selbstoptimierungsdruck, soziale Vergleichskultur |
👉 Theorie betont: Es ist nie nur „der Job“. Es ist das Zusammenspiel aus individuellen, sozialen und strukturellen Faktoren.
Schutzfaktoren: Was wirkt laut Forschung präventiv?
Selbstwirksamkeit: Das Gefühl, Einfluss auf Situationen zu haben
Emotionale Intelligenz: Gefühle wahrnehmen und regulieren können
Soziale Unterstützung: Ein stabiles Netz aus Beziehungen
Sinnwahrnehmung: Die Arbeit (oder das Leben) als bedeutsam empfinden
Erholungsfähigkeit: Die Fähigkeit, sich von Belastung zu lösen (z. B. „psychologische Detachment“)
Diese Schutzfaktoren werden häufig in Präventionskonzepten wie dem BOSS-Modell, Resilienztrainings oder Salutogenese-basierten Programmen theoretisch aufgegriffen.
Abgrenzung: Prävention ≠ Intervention
Burnout-Prävention zielt nicht darauf ab, therapeutisch zu behandeln – sondern vorzubeugen, zu stabilisieren, Bewusstsein zu schaffen.
Unterschiede auf theoretischer Ebene:
| Prävention | Intervention |
|---|---|
| Fokus auf gesunde, gefährdete Personen | Fokus auf bereits erkrankte Personen |
| Stärkung von Ressourcen | Linderung von Symptomen |
| Aufklärung & Früherkennung | Therapie, ggf. medikamentös |
| z. B. Stressbewusstsein, Coping-Fähigkeiten | z. B. Verhaltenstherapie, Arbeitsunfähigkeit |
Fazit
Burnout-Prävention ist auf theoretischer Ebene mehr als ein „guter Vorsatz zum Abschalten“. Sie basiert auf fundierten Modellen, die zeigen:
👉 Ob jemand ausbrennt, hängt nicht allein von der Arbeitslast ab – sondern davon, wie Belastung verarbeitet und bewertet wird.
Je besser wir diese Mechanismen verstehen, desto gezielter können wir Risiken erkennen – und schützen.
Ausblick
Wie erkennt man Burnout frühzeitig – auf fundierter, diagnostischer Grundlage?
Im fünften und letzten Teil der Blogreihe schauen wir auf Definitionen, Abgrenzungen und Erkennungsmerkmale, wie sie in Theorie, Klassifikation und Forschung genutzt werden.
👉 Hier geht’s weiter:
„Burnout erkennen – Diagnostische Kriterien, Selbsttests und Abgrenzung zur Depression“
Teilen mit:
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp
- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram
- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook
- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Tumblr

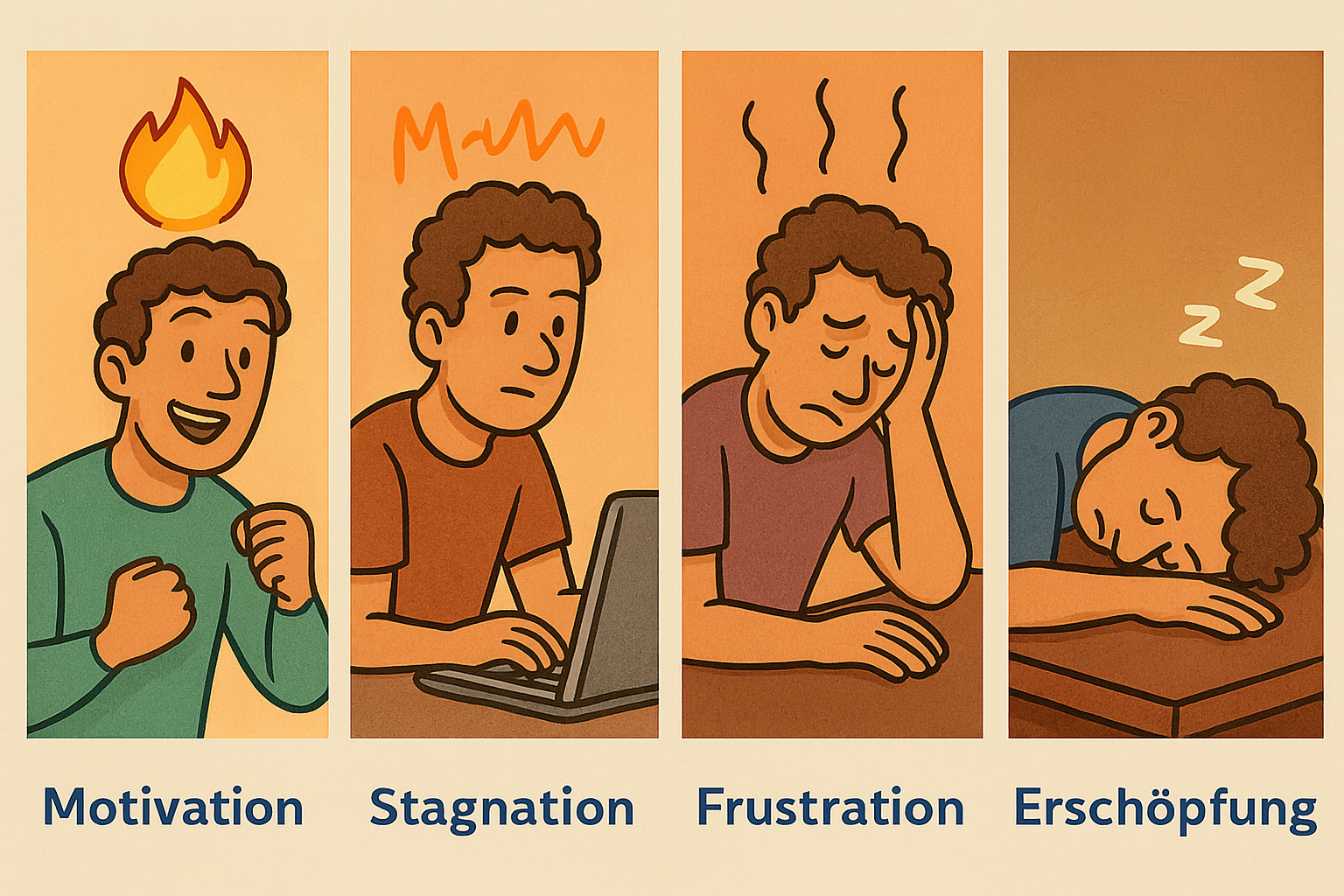

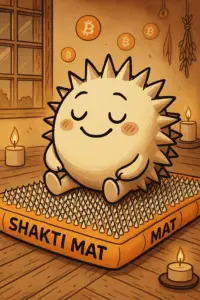



Kommentar veröffentlichen