Der Burnout-Verlauf – Vom inneren Funken bis zur völligen Erschöpfung
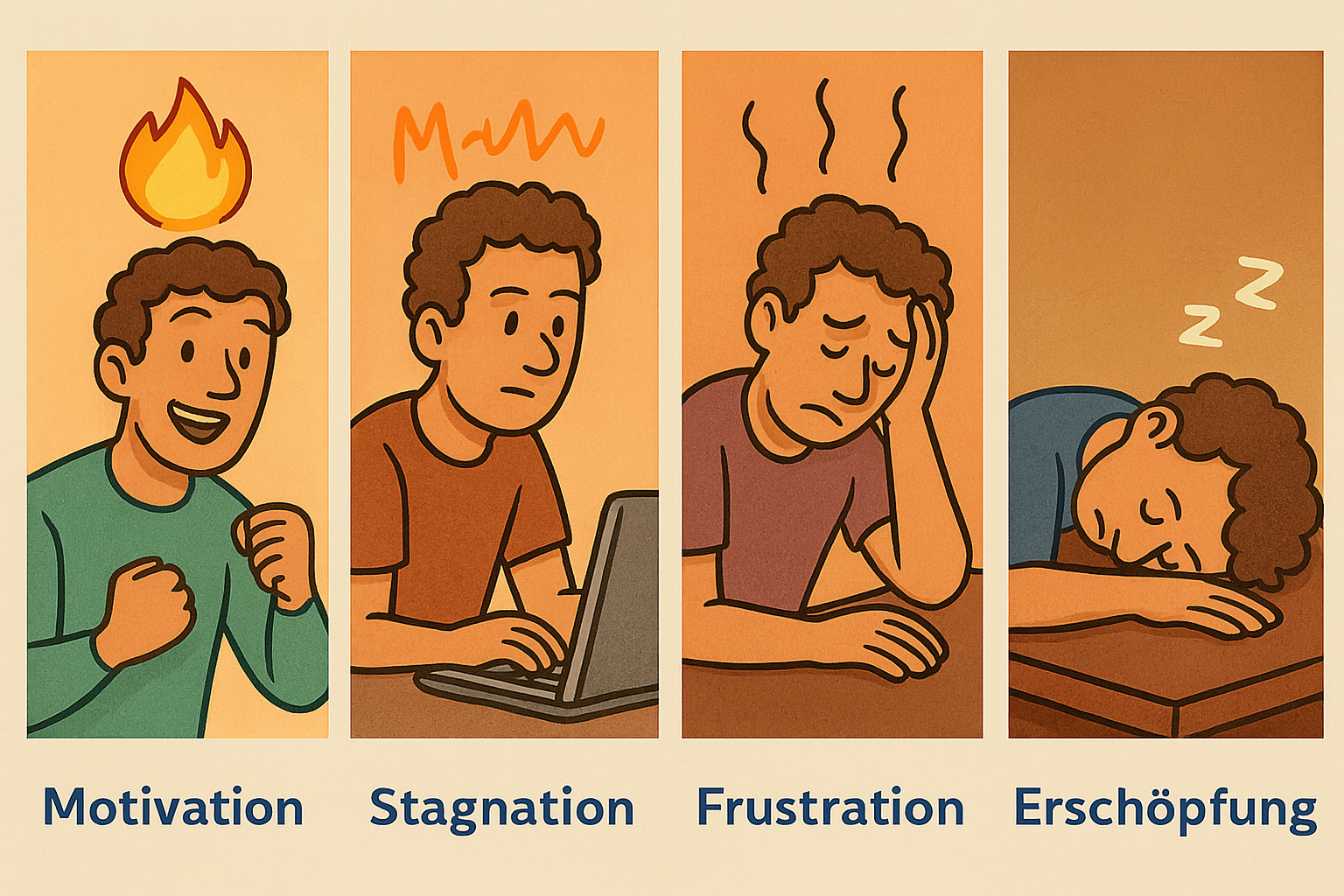
Burnout ist kein plötzlicher Zusammenbruch, sondern ein schleichender Prozess. Viele Betroffene spüren lange Zeit, dass „etwas nicht stimmt“ – können es aber nicht benennen oder ignorieren die Warnsignale. Erst wenn Körper, Psyche und Geist nicht mehr „funktionieren“, wird klar: Es geht nicht mehr.
In diesem Beitrag schauen wir uns den theoretischen Verlauf von Burnout an – inklusive der bekannten 12-Phasen-Modells nach Freudenberger und North.
Burnout beginnt oft mit Engagement
Ironischerweise beginnt der Burnout-Prozess häufig nicht mit Überforderung, sondern mit überhöhtem Einsatz. Viele Betroffene sind idealistisch, motiviert, engagiert. Sie brennen für das, was sie tun – und verlieren dabei oft die Verbindung zu den eigenen Grenzen.
Diese erste Phase wirkt nach außen positiv. Doch intern entsteht ein Ungleichgewicht: Zwischen Energieeinsatz und innerer Regeneration klafft eine immer größere Lücke.
Das 12-Phasen-Modell nach Freudenberger & North
Das Modell beschreibt den Burnout-Verlauf in 12 aufeinanderfolgenden, teils überlappenden Phasen. Es ist kein Diagnoseinstrument, sondern ein Erklärungsansatz, um typische Entwicklungen besser zu verstehen.
1. Der Zwang, sich zu beweisen
Überhöhter Ehrgeiz
Drang, sich unentbehrlich zu machen
2. Verstärkter Einsatz
Überstunden, Arbeit mit nach Hause nehmen
Keine Pausen, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse
3. Vernachlässigung eigener Bedürfnisse
Schlaf, Ernährung, soziale Kontakte werden zweitrangig
4. Verdrängung von Konflikten
Erste innere Spannungen
Ärger, Frust oder Müdigkeit werden ignoriert
5. Umdeutung von Werten
Hobbys oder Familie verlieren an Bedeutung
„Ich hab keine Zeit für so was.“
6. Verstärkte Verleugnung der Probleme
Zynismus, Gereiztheit, wachsender Frust über „die anderen“
7. Rückzug
Soziale Isolation, weniger Interesse an Kontakten
Erhöhtes Suchtverhalten möglich (z. B. Alkohol, Essen, Medienkonsum)
8. Verhaltensveränderung
Unflexibilität, emotionale Kälte, Unnahbarkeit
9. Depersonalisation
Eigene Identität verschwimmt
„Funktionieren“ wird zum Lebensprinzip
10. Innere Leere
Gefühl innerer Taubheit, Leere oder Sinnlosigkeit
11. Depression
Hoffnungslosigkeit, Selbstwertprobleme, teilweise Suizidgedanken
12. Völlige Erschöpfung
Körperlich, emotional, geistig – nichts geht mehr
Typische Symptome im Verlauf
| Frühphase | Mittelphase | Endphase |
|---|---|---|
| Überengagement, Perfektionismus | Schlafstörungen, Reizbarkeit, Rückzug | Depression, Erschöpfung, Zusammenbruch |
| Keine Zeit für Erholung | Zynismus, Leistungsabfall | Arbeitsunfähigkeit, psychosomatische Beschwerden |
Wichtig: Nicht jeder durchläuft alle Phasen in gleicher Intensität oder Reihenfolge. Manche Prozesse verlaufen schneller, andere über Jahre hinweg.
Warum erkennen viele Betroffene den Verlauf nicht?
Weil Burnout tarnfähig ist.
In der Anfangsphase wird Überengagement oft gelobt („So ein Einsatz!“)
Symptome wie Reizbarkeit oder Rückzug werden als „Persönlichkeitsveränderung“ missverstanden
Erschöpfung wird bagatellisiert: „Ich hab halt viel um die Ohren“
Der innere Anspruch zu funktionieren ist oft stärker als die Warnsignale
Zudem fehlt es oft an Wissen – sowohl bei Betroffenen als auch im Umfeld.
Burnout als Abwärtsspirale
Der Verlauf lässt sich auch als Erschöpfungskaskade beschreiben:
Überforderung →
Anpassung auf Kosten der eigenen Ressourcen →
Kompensation durch Kontrolle, Rückzug oder Zynismus →
Verlust von Energie, Motivation, Identität
Am Ende steht nicht nur die Arbeitsunfähigkeit, sondern häufig eine Entfremdung von sich selbst.
Zusammenfassung
| Aspekt | Erklärung |
|---|---|
| Modell | 12-Phasen-Modell nach Freudenberger & North |
| Verlauf | Schleichend, nicht linear |
| Frühzeichen | Überengagement, Perfektionismus, soziale Vernachlässigung |
| Spätzeichen | Rückzug, Erschöpfung, Depression, Identitätsverlust |
| Kritik | Modell ist nicht diagnostisch, aber hilfreich zur Orientierung |
Ausblick
Wenn du Burnout verstehen willst, musst du seine Entstehung kennen – und seinen Verlauf. Im nächsten Teil wenden wir uns der Frage zu: Was sagt die Theorie über Prävention? Welche Modelle helfen uns, das Risiko zu erkennen – lange bevor Symptome auftreten?
👉 Lies auch:
„Burnout-Prävention aus theoretischer Sicht – Modelle, Faktoren, Risiken“
Teilen mit:
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp
- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram
- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook
- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Tumblr

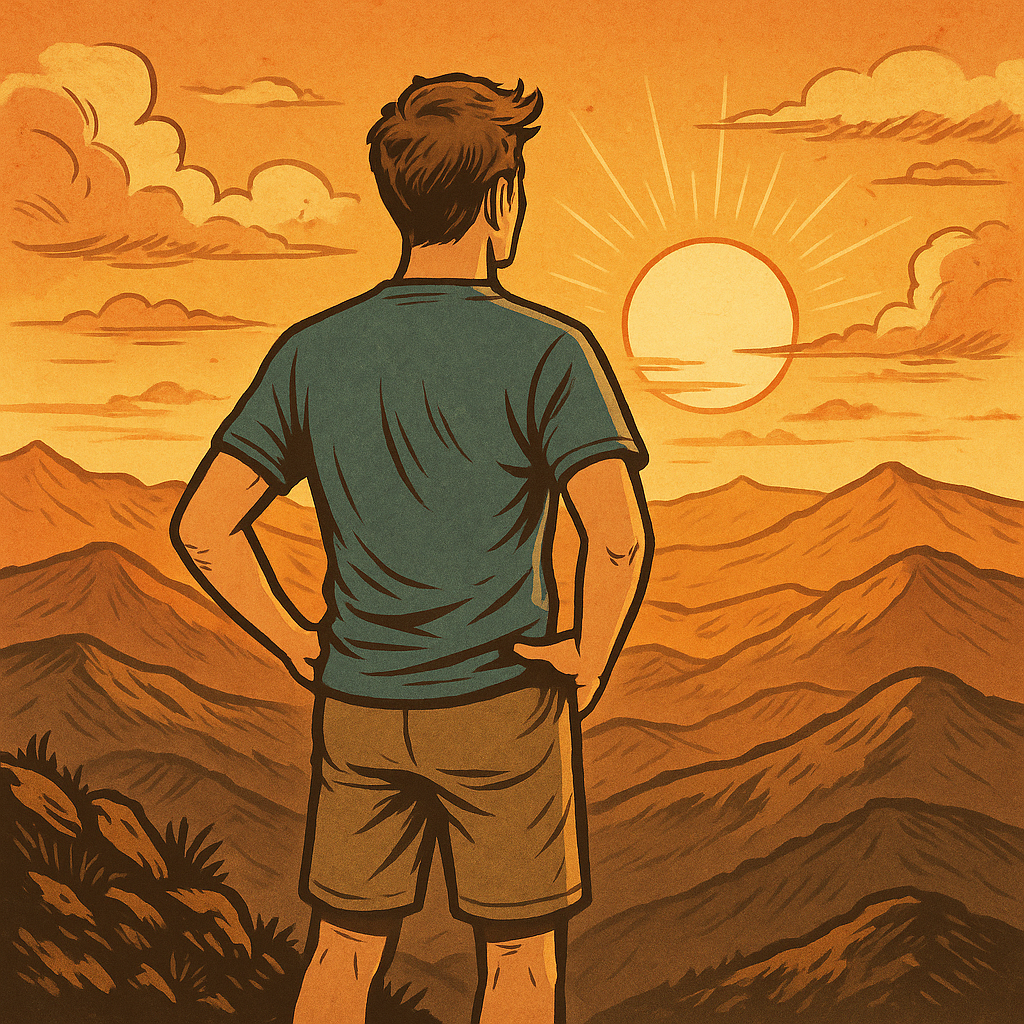

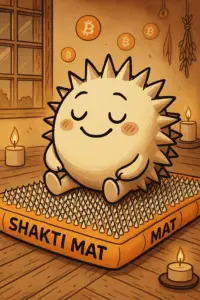



Kommentar veröffentlichen